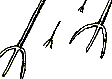
Ensemma Schbrìch
Redensarten, Ausdrücke und Sprüche
|
Ensemma Schbrìch Redensarten, Ausdrücke und Sprüche |
|---|
![]()
9. Glaube & Aberglaube
Glaube und Aberglaube liegen - wie Liebe und Hass - ganz eng beieinander. Ensheim ist ein Dorf, das seit Jahrhunderten katholisch[1] geprägt ist. Kein Wunder also, dass auch viele Ausdrücke und Redensarten sich auf den (katholischen) Glauben und sein Gegenteil beziehen.
Eine
zentrale Rolle im Katholizismus spielt die Heilige
Messe. Wann sie stattfindet, wird im Nachrichtenblatt der Pfarrei veröffentlicht
bzw. wie von alters her durch das Glockenläuten publik gemacht:
·
im Kirche|blädd|che (~|blääd|che) schdehn
(i.ü.S.: im Nachrichtenblatt der Pfarrei veröffentlicht sein)
·
medde Glògge zingge (sagt man, wenn die Glocken einzeln angeschlagen
werden) ð
„Awill zinggds schùnn! Dùmmel dich, glich dùdd’s sòmme| liLLe!“
·
„‘S dùdd sòmme|liLLe!“ (w.:
„Es läutet zusammen!“ I.ü.S.: Das sagt man, wenn es zum zweitenmal zur Hl.
Messe läutet.)
·
alle|gebodd in die Kirch ränne (oft
zur Hl. Messe gehen; pej.) ð
„‘S Seffa gähng rächda mòòl im Gaade schaffe als allegebodd in
die Kirch se ränne!“ (Die Josefa würde besser mal im Garten arbeiten als
allzuoft in die Kirche zu rennen!)[2]
·
ùff die Bòòrkirch gehn (auf die Empore gehen) ð „Wääsche,
ich genn gäär in die Kirch, awwa dònn sinnich delìebschd ùff da Bòòrkirch!“
·
‘s Obba|kärbche in die Prässkòmma tròòn
(das Opferkörbchen nach der Sammlung in die Sakristei tragen)
·
fa die HääLe|kenn bääLe; ~ sòmm(e)le
(w.: für die Heidenkinder[3]
beten; i.ü.S.: für ungetaufte Kinder beten; ~ Geld sammeln)
·
de Sään ussdääle
(den Segen
austeilen; segnen)
·
in de Himmel kùmme
(in den
Himmel kommen)
![]()
Viele Ausdrücke beziehen sich auf bestimmte, alljährlich wiederkehrende Abläufe des Kirchenjahres
·
de Blasijus|sää'e hòlle (w.: den Blasius-Segen holen; sich an St. Blasius
segnen lassen)[4]
·
sich ‘s Äsche|grìddsje hòlle (w.: sich das Aschenkreuz holen; i.ü.S.: sich am
Aschermittwoch vom Pfarrer ein Kreuz aus Asche auf die Stirn malen lassen)
·
òn Pälm|sùnndaa in die Mäss gehn (w.: an Palmsonntag die Messe besuchen)
·
de Pälm wäihe lònn
(an
Palmsonntag Palmwedel segnen lassen, die im Haus und im Stall aufgehängt
wurden)
·
nòhm Ooschda|fier lùù’e gehn (w.:dem Osterfeuer zuschauen)
·
in die Ooschda|mäss gehn (w.: die Ostermesse besuchen)
·
vùnn da Mussigg abgehòll wärre (sagt
man, wenn die Kommunionkinder von der Musikkapelle des MV Arion an der alten
Schule abgeholt werden, um in einer gemeinsamen Prozession zur Kirche zu laufen,
wo sie dann ihre erste Kommunion empfangen.)
·
in die Mai|òndachd gehn (w.: die Maiandacht besuchen)
·
e Prossjoon mache (eine Prozession machen)
·
medda Prossjoon gehn
(an der
Prozession teilnehmen)
·
fa de Froo(n)läichnùmms|daa e Aldäärche bou’e
(für die Prozession an Fronleichnam einen kleinen Altar herrichten)[5]
·
de Himmel tròòn (bei der Prozession an Fronleichnam den Baldachin tragen, unter dem
sich der Pfarrer mit der Monstranz in den Händen befindet; eine ehrenvolle
Aufgabe, die in der Regel durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erledigt
wird)
·
Muus piddschele gehn
(i.ü.S.:
Moos sammeln für den Fronleichnamsaltar)
·
de Wirdswich sääne lònn (w.: ein Kräuterbündel segnen lassen)[6]
Taufe, Heirat und Beerdigung sind wichtige Kulthandlungen in der katholischen Kirche. Auch sie tauchen in einigen Wendungen wieder auf:
·
in wiss häiraade (w.: in weiß heiraten; i.ü.S.: kirchlich heiraten)
ð „Jòò,
nòhm Grìech hadd ma känn Mummes gehaad, fa in wiss se häiraade!“ (Nach
dem Krieg hatte man kein Geld, um eine kirchliche Heirat zu finan-zieren.)
·
‘s Kend dääfe lònn
(das
neugeborene Kind taufen lassen) ð
„Ich wääß aa nìdd, wass dass fòrne sìnn! Die hònn ìhr Kend gaa nìdd
dääfe gelass!“ (Ich weiß nicht, was das für Leute sind! Die haben ihr
Kind gar nicht taufen lassen!)
·
Kenndääfs|gùùdsja wärfe (w.:
Bonbons zur Kindstaufe werfen) - Früher war es die vornehme Aufgabe der Paten,
von Padd ùnn Gòòd also, nach der
Taufe vor der Kirche Bonbons unter die dort wartende Kinderschar zu werfen. Wer
etwas auf sich hielt, verteilte gute Qualität, andere warfen den letzten
„Schrott“ unter die Leute.[7]
·
‘s Schìeß|bìer drìngge (w.:
das Schießbier trinken).[8]
·
bäi de Schìeß|bùwwe sìnn (w.: bei den Schießbuben sein).
·
e scheeni Läichd hònn (w.: ein schönes, feierliches Begräbnis haben)
·
die Hùdd
va|sùffe (w.: die Haut versaufen. - Nach dem Begräbnis lädt man die
Verwandten, Freunde und Nachbarn des Verstorbenen zum Kaffee in ein Gasthaus
ein.) ð „De
Kreschóòn ìsch jeddse aa ùnna da Ärd ùnn henna|häär hòmma noch bäi Därre
die Hùdd va|soff!“ (Den Christian haben wir jetzt auch begraben und
hinterher waren wir im Gasthaus Kohl zum Kaffeetrinken eingeladen.)
![]()
Weitere Ausdrücke und Wendungen zum Thema:
·
òn die Grodd bääLe gehn (zum Beten zur Muttergottesgrotte an der Kreuz-gasse
im Heimel gehen) ð
„Jòò! Jòò! ‘S Luwwies ìschòò aa so gròngk! Awwa ‘s gedd
allegebodd òn die Grodd bääLe! Wänn’sem nùrre hälfe dùdd!“
·
de Pillcha uss|tròòn (den Pilger
- das Mitteilungsblatt des Bistums Speyer - an die katholischen Haushalte
verteilen, die diese Zeitung abonniert haben)
·
scheen preLLiche (w.: schön predigen; i.ü.S.: eine unterhaltsame,
kurzweilige oder nachdenkenswerte Predigt halten). ð „Zìnnda
dassma dänne noue Paschdoor hònn, gedd unsa Eliss wiLLa in die Kirch; däär gähng
jòò so scheen preLLiche! Oh, ‘s ìsch gòns ewägg meLLem!“ (Seit wir
einen neuen Pfarrer haben, besucht unsere Elisabeth wieder die Hl. Messe. Seine
Predigten seien überhaupt nicht langweilig. Oh, sie ist ganz hingerissen von
ihm!)
·
e Gegrießed|seìsch|du|maria ùff|gänn (w.:
nach der Beichte ein besonderes Gebet <„Gegrüßet seist du, Maria“>
als Buße aufgeben)
·
e Vaada|unsa ùff|gänn (w.: ein „Vaterunser“ als Buße aufgeben)
·
gùdd kaddolìsch sìnn (ausgeprägt katholisch sein - in Ensheim aufgrund
der Geschichte eine nach wie vor wichtige Eigenschaft für die gesellschaftliche
Integration)[9]
ð „Jòò!
Jòò! De Schorsch ùnn’s Leenche, die ware schùnn imma gùdd kaddolisch, dòò
gìdd’s nìggs!“
„Wännde mich schunn wach michschd, dònn schdell mich aa ùff die Bään!“ (Das sagt Tante Emma morgens nach dem Aufstehen im Zwiegespräch mit Gott. Darin ist der Wunsch sichtbar, möglichst im Schlaf und ohne Leiden zu sterben - aber möglichst noch nicht gleich heute!)
![]()
Als gute(r) Katholik(in) hat man diverse Verpflichtungen zu übernehmen:
·
in die Bichd|schdùnn gehn (i.ü.S.:
zur Beichte gehen)
·
e Bichd|zeddel schriewe (w.: einen Beichtzettel schreiben)[10]
·
de Bichd|zeddel abgänn (w.: den Beichtzettel <nach der Beichte an den
Pfarrer> abgeben)
·
Dialog
nach der Beichte: „Wass hadden de
Paschdoor dier ùffgänn?“ - „Ei,
fìnnef Vaada|unsa ùnn dräi Gegrießed|seìsch| du|maria!“
·
ins Hooch|òmd gehn
(an der
sonntäglichen Hauptmesse teilnehmen)
·
in die Väschba gehn (an der Vespermesse teilnehmen)[11]
·
‘s Naach(d)|mòòl hòlle (die
heilige Kommunion empfangen)
·
um’s Obba gehn
(i.ü.S.: um
den Altar gehen und ein Opfer bringen)
·
medda Läichd gehn (i.ü.S.: am Begräbnis teilnehmen)
·
Padd ùnn Gòòd schbìele (i.ü.S.: eine Patenschaft für ein Neugeborenes übernehmen)[12]
·
die Firmgòòd mache
(die Rolle
einer Firmpatin übernehmen)
·
de Firmpadd mache (die Rolle eines Firmpaten übernehmen)
![]()
Der eine oder andere Katholik, auch aus Ensheim, entschließt sich dazu, Priester zu werden. Dazu gibt es die folgenden Wendungen:
·
wivvel Paschdeer in da Vawòndschafd hònn
(i.ü.S.: etliche katholische Priester in seiner Familie haben)
·
Paschdoor
wärre wille
(w.: katholischer Geistlicher werden wollen; meist mit einem Unterton der
Anerkennung oder auch Überraschung) ð „Du, Mienche, hasches schùnn gehäärd? Em Marieche sinn Bùùb will
aa Paschdoor wärre! Dass ìsch doch scheen, gällnää!“
Der katholische Geistliche braucht bei der Feier der Heiligen Messe eifrige Helfer – die Messdiener und Messdienerinnen und die Laienhelfer:
·
sùnndaas in da Mäss vòòr|bääLe (w.: sonntags in der Messe vorbeten; i.ü.S.:
den Pfarrer bei der Gestaltung der Hl. Messe unterstützen, in dem man einen
Bibeltext oder eine Fürbitte vorliest)
·
die Liddanei bääLe (w.: die Litanei beten). Darunter versteht man in
der katholischen Liturgie ein
alternierendes Flehgebet aus aneinandergereihten Anliegen oder Anrufungen des
Vorbeters und gleichbleibenden Antworten der Gemeinde.[13]
·
bäi
de Mäss|dìena sìnn
(Messdiener sein)
·
bäi
de Kläbba|bùwwe sìnn (i.ü.S.:
als Messdiener die Gläubigen mit einer Ratsche zum Gottesdienst rufen)
·
sich
e Räddsch boue lònn
(sich eine Ratsche anfertigen lassen, um als „Kläbba|bùùb“ tätig zu
werden)
![]()
Immer wieder gibt es auch Mitmenschen, die alles übertreiben – auch ihren Glauben. Auf diese Weise kann der Glaube sehr leicht zum Aberglauben oder Irrglauben werden – auch aus katholischer Sicht:
·
bigoddich
sìnn
(bigott, frömmelnd, blindgläubig sein) ð
„‘S Malche soll nùrre die Schnìss haLLe, dass ìsch doch sälwa
bigoddich bis dòrdenuss!“ (Amalie soll bloß den Mund halten! Sie ist
doch selbst überaus bigott!“) ð
„Dass sìnn bigoddiche Lied!“ (Das sind Leute, die es mit der Frömmigkeit
übertreiben!)
·
"Dassäll
bääd em Härrgodd noch die Zeewe ab!" (w.: Diese Frau betet dem Herrgott noch die Zehen
ab. I.ü.S.: Sie übertreibt es mit dem Beten. Sie vergisst vor lauter Beten
ihre eigentlichen Aufgaben.)
![]()
Natürlich gibt es auch in Ensheim Menschen, die mit der Kirche nicht viel am Hut haben oder ihr auch – aus den verschiedensten Gründen - gar nicht mehr angehören. Dies ist nach katholischer Lesart nicht ungefährlich, denn sie könnten
·
in die Hell kùmme (in die Hölle kommen) ð
„Jedds fòllich, sùnsch(d) kimmsche in die Hell!“ (Jetzt sei
artig, sonst kommst du in die Hölle)[14]
·
medd
Schùh ùnn Schdrimb in die Hell kùmme (w.: mit Schuhen und Strümpfen in die Hölle kommen; i.ü.S.: ganz
bestimmt in die Hölle kommen) oder
gar
·
in die unnaschd Hell kùmme (w.: in die unterste Hölle kommen; also dahin, wo
es kein Entrinnen nach oben mehr geben kann).
·
ins Feech|fier kùmme (ins Fegefeuer kommen) - Dies ist eine Veranstaltung
für kleine und für reuige Sünder, die durchaus noch die Chance haben für’s
himmlische Paradies.[15]
·
in känn Kirch gehn (den Gottesdienst mit voller Absicht nicht besuchen;
nicht besonders fromm sein) ð
„Dass hadd jòò so kùmme misse medd dämmsääl; däär gedd jòò aa
in känn Kirch!“ (Dass es mit ihm soweit gekommen ist, wundert mich nicht,
denn er ist nicht sonderlich fromm.)
·
känn
Godd ùnn känn Gebodd känne
(w.: keinen Gott und kein Gebot kennen; i.ü.S.: sich an nichts halten;
keinerlei Regeln beachten) ð
„So e Dùnna|wäLLa! Däär kännd doch känn Godd ùnn känn Gebodd!“
(Solch ein schlimmer Bursche! Der hält keine Regeln ein!)
·
uss
da Kirch uss|trääLe
(w.: aus der Kirche austreten)
·
sinne Kenn nìdd dääfe lònn (w.: seine Kinder nicht taufen lassen) ð „Hasches
schùnn gehärd? Em Mien|che sinna hadd sinne Kenn aa nìdd dääfe gelass. Wass
soll dass nùrre noch gänn medd dänne?“ (Hast Du schon gehört?
Wilhelmines Sohn hat seine Kinder auch nicht taufen lassen! Wo soll das bloß
noch hinführen?)
·
nìdd gedääfd sìnn (ungetauft sein). Dieser Ausdruck wird negativ
gebraucht, wenn man deutlich machen will, dass ein Mitbürger es wagt, sein Kind
nicht taufen zu lassen. ð
„Uss dämm kònn jòò nìggs wärre; däär ìschòò noch nìddemòòls
gedääfd!“ (Aus dem Kind kann nichts werden! Wie auch, denn es ist noch
nicht einmal getauft.)
![]()
Auch einer anderen Religion anzugehören, geziemt sich nicht, denn viele Katholiken sind anderen Religionen gegenüber sehr intolerant:
·
prodde|schdòndìsch sìnn (w.: protestantisch sein - Das trifft in Ensheim nur
auf eine Minderheit zu. Der Begriff selbst hat noch immer einen leicht
nega-tiven Beigeschmack.) ð „Ou,
Fienche, hasches schùnn gehärd? Em Luij sinn jingschdes MähLe hadd jeddse aa
noch änna gefùnn. Jòò, schìnnd so gòns padänd se sìnn. Ach, wänna nùrre
nìdd proddeschdòndisch wär!“ (Oh, Josefine, hast du schon gehört?
Ludwigs jüngste Tochter hat jetzt auch noch einen Mann gefunden. Er scheint
ganz patent zu sein. Ach, wenn er nur nicht evangelisch wäre!)[16]
·
bäi de JuLLe sìnn (w.: bei den Juden sein: i.ü.S.: der jüdischen
Glaubensgemeinschaft angehören)
![]()
Der Teufel spielt als Antichrist in der katholischen Religion natürlich eine besondere Rolle, wird er doch für alles Schlechte verantwortlich gemacht.
Auf ihn beziehen sich auch eine Reihe von Ausdrücken[17]:
·
„De Däiwel soll dich hòlle!“ (w.: „Der Teufel soll dich holen!“) - Eine
deutliche Warnung an jemanden, der einfach nicht brav sein will oder den man
verfluchen möchte.
·
„Wämma vùmm Däiwel schwäddsd, dònn kimmda!“
(w.: „Wenn man vom Teufel redet, dann kommt er.“) - Man benutzt diese
Redensart, wenn man sich gerade über eine Person unterhält und diese noch während
der Unterhaltung oder kurz danach unvermittelt auftaucht.
·
„Wännde Däiwel ‘s Pärrd helld, kònna de Zòòm aa noch hòlle!“
(w.: Wenn der Teufel das Pferd holt, dann kann er auch den Zaum mitnehmen. I.ü.S.:
Wer sich von einer Sache den Löwenanteil sichert, kann auch noch den kleinen
Rest mitnehmen.)
·
de Däiwel im Pòns hòns (w.: den Teufel im Leib haben; i.ü.S.: wild,
unbeherrscht, temperamentvoll sein)[18]
·
„De
Bärch erùnna hälfe all Hääliche, awwa de Bärch erùff känn Däiwel!“
(w.: Wenn es den Berg runter geht, helfen alle Heiligen, aber wenn es den Berg
rauf geht, hilft kein Teufel! I.ü.S.: Bei leichten Arbeiten wollen alle helfen,
bei schweren niemand.)
![]()
Was es noch so gibt:
·
„Aldäärches|bou’a! Lied|beschissa!“
(So betitelte ein gewisser Motsch
Ensheimer Kaufleute, die seiner Meinung nach an Fronleichnam scheinheilig einen
Altar errichteten, aber sonst ihre Kunden betrogen.)[19]
·
zùmm Paschdoor gehn (w.: zum Pastor gehen; i.ü.S.: dem Herrn Pfarrer ein
dringendes Anliegen vortragen) ð
„Wännde widdschda medd dämmsäll fräie gesch, genn ich zum Paschdoor!“
(Wenn du weiterhin eine Beziehung zu dieser Frau unterhälst, gehe ich zum Herrn
Pfarrer und bitte ihn um eine Intervention.)
·
„Die Glogge sìnn nòh Rom bääLe!“ (w.: Die Glocken sind nach Rom zum Beten.) -
Das sagt man, wenn zwischen Karfreitag und Ostersonntag kein Glockengeläut zu hören
ist. In dieser Zeit werden die Gläubigen „vunn de Kläbba|buwwe“[20]
zum Gottesdienst gerufen.
Anmerkungen
[1] Zu Beginn des 17. Jh. versuchte die Reformation unter dem Einfluss der lutherischen Grafen von Nassau-Saarbrücken, welche die weltlichen Oberherren der Ensheimer Bevölkerung waren, in Ensheim Fuß zu fassen, vermochte sich aber nur knapp achtzig Jahre zu behaupten. Die dann unter französischem Einfluss einsetzende Gegenreformation hat die Stellung des Katholizismus in Ensheim auf Dauer stabilisiert.
[2] Aus diesem Beispiel spricht eine kritische Haltung gegenüber zu vielen Kirchenbesuchen. In der Tat liegen ja echte Frömmigkeit und bigottes Verhalten recht eng beisammen...
[3] Es ist symptomatisch für die meisten Religionen, auch für den Katholizismus, dass Andersdenkende immer wieder mal verunglimpft werden, in diesem Fall nichtchristliche Kinder als HääLe|kenn.
[4] St. Blasius war der Schutzpatron der Fischer. Wer am 3. Februar diesen Segen bekam, musste nach der katholischen Lehre nicht fürchten, sich an einer Fischgräte zu verschlucken. Außerdem soll dieser Segen vor Halsschmerzen schützen. Vgl. Braun, op. cit., 65.
[5] Ein solcher Altar wird von Anwohnern an einer Stelle gebaut, wo die Prozession vorbeiführt.
[6] Am „Wirdswich|daa“ (15. August) wurden von den Kindern und Frauen Kräuter gesammelt und zu einem kleinen Strauß gebunden und danach zur Weihe in die Kirche getragen. Zu Hause wurden die Sträuße in den Stall oder auf den Dachboden gehängt, um so für Schutz vor einem Unwetter zu sorgen.
[7] Ich persönlich habe vor allem die Schummbohn|gùùdsja in sehr guter Erinnerung; auf die bin ich als Kind - in einer Zeit, wo es kaum Süßigkeiten gab und eine Tafel Schokolade für uns Kinder ein Riesenereignis war - regelrecht „abgefahren“...
[8] Nachdem die Glocken das Ende der Taufe angekündigt hatten, traten die Schìeß|bùwwe, Freunde oder Arbeitskollegen des Kindvaters, in Aktion: mit Gas gefüllte Ballons wurden an einer im Garten oder auf einer Obstbaumwiese gespannten Leine aufgehängt und anschließend beim Schìeße durch einen mit Benzin getränkten und dann entzündeten Lappen, der am vorderen Ende einer Bohnenstange befestigt war, zur Explosion gebracht. Nach getaner „Arbeit“ wurden sie auf Kosten des Kindsvaters entweder zum Schìeß|bìer in eine Kneipe eingeladen oder sie bekamen ein kleines Fass Bier, das in einer meist fröhlichen Runde zusammen geleert wurde.
[9] Wie hatte mich seinerzeit meine Tante gefragt, als ich ihr meine Freundin Ingrid vorgestellt hatte: Isch’s aa kaddolìsch? Ich hatte Glück: zufällig war sie katholisch...
[10] Einen solchen Beichtzettel verlangte beispielsweise Pfarrer Konrad noch in den 1960er Jahren von den beichtenden Jugendlichen, auch von mir: auf dem Zettel musste man seine Sünden vermerken; bei der Beichte las man die Sünden vom Zettel ab. Nach der Beichte musste man ihn durch eine kleine Öffnung in der Trennwand an den Pfarrer durchreichen, der ihn aber nicht mehr zurückgab... Das ist eine katholische Variante von Gesinnungsschnüffelei, die es heute zum Glück nicht mehr gibt.
[11] Das Wort leitet sich vom lat. vespera <Abend> ab und bezeichnet die abendliche Gebetsstunde in der Kath. Kirche.
[12] Die Gòòd stammt ebenso wie die verkleinerte Form Gòòdche aus dem Alemannischen: Gotte <Patin>. Vgl. Seibicke, op. cit., 117.
[13] Meyers Grosses Taschenlexikon in 24 Bänden. Band 13. Mannheim, Wien, Zürich 1981, 174f.
[14] Mit dieser zweifelhaften Drohung haben Generationen von katholischen Eltern und Großeltern ihre Kinder bzw. Enkel zum Gehorsam bringen wollen.
[15] Die katholische Lehre vom Fegefeuer geht davon aus, dass im Tode über das Schicksal des Menschen entschieden wird. Das Fegefeuer bedeutet so die Läuterung des Menschen nach dem Tod. – Meyers Grosses Taschenlexikon in 24 Bänden, Band 7, Mannheim 1981, 10.
[16] Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Anfang der Sechziger Jahre katholische Schulkinder auf dem Schulhof protestantische Kinder verhauen haben – und umgekehrt. Ein ganz kleines „Nordirland“ auf dem Dorfe...
[17] Der Duden, op. cit., 718 ff verzeichnet 49 (!) Wendungen, die sich auf den Teufel beziehen.
[18] Laut Duden, op. cit., 719 nahm man früher als Ursache von Krankheiten an, dass der Teufel in den Leib des Menschen gefahren sei. Dies sei vor allem bei Tobsucht der Fall gewesen. In der Tat gibt es ja auch heute noch (illegale) Teufelsaustreibungen – hin und wieder sogar in Deutschland.
[19] Vgl. dazu auch S. 286, Anm. 659.
[20] Heutzutage hat sich auch bei dieser Institution die Emanzipation durchgesetzt: jetzt gibt es auch „Kläbba|mähle“...
![]()
© Paul Glass 2000-2001